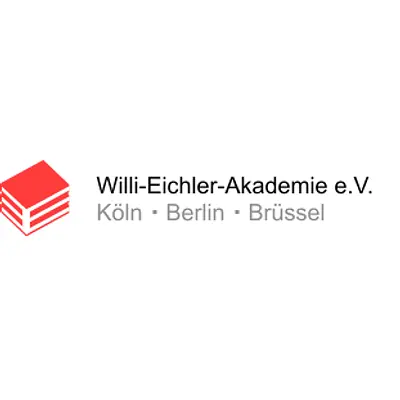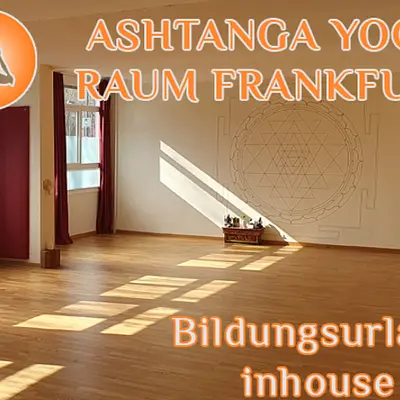Inhalt des Kurses
Für jüngere Angehörige stellt es sich häufig als schwierig dar, die eigenen Verwandten nach der
Familiengeschichte während des Nationalsozialismus zu fragen: Die damals lebenden Angehörigen
haben sie meist nicht kennengelernt, es sind nur Fragmente über ihre Lebensgeschichten zwischen
1930 und 1945 bekannt oder es wurde Jahrzehnte über diesen Aspekt der Familienvergangenheit
geschwiegen. In familiär überlieferten Erzählungen stehen häufig die Leiderfahrungen nicht-verfolgter
Angehöriger, etwa während der Kriegsgefangenschaft, der Bombardierung oder Nachkriegszeit, im
Vordergrund. Selten treten sie a...
Familiengeschichte während des Nationalsozialismus zu fragen: Die damals lebenden Angehörigen
haben sie meist nicht kennengelernt, es sind nur Fragmente über ihre Lebensgeschichten zwischen
1930 und 1945 bekannt oder es wurde Jahrzehnte über diesen Aspekt der Familienvergangenheit
geschwiegen. In familiär überlieferten Erzählungen stehen häufig die Leiderfahrungen nicht-verfolgter
Angehöriger, etwa während der Kriegsgefangenschaft, der Bombardierung oder Nachkriegszeit, im
Vordergrund. Selten treten sie a...